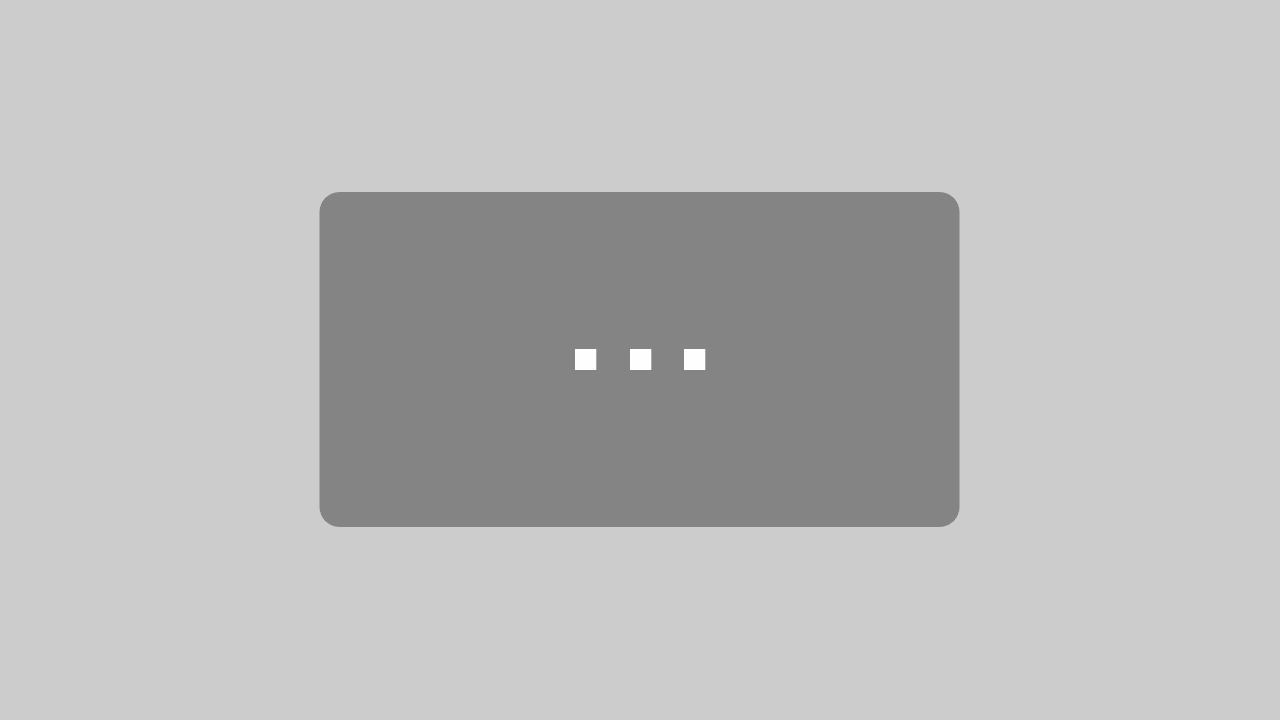Denkt man an Venedig, denkt man zuerst an prachtvolle Palazzi, azurblaue Kanäle und singende Gondolieri. Aber manch einer denkt vielleicht auch an die berühmten Glasbläser von der Insel Murano. Nicht nur ihr brandgefährlicher Beruf führte die Glasbläser 1295 aus Venedig auf die Insel. Hier galt es vor allem, das größte Geheimnis Venedigs zu schützen. Glashersteller waren gezwungen mit ihren Familien auf der Insel zu leben und durften sie nur mit einer Genehmigung verlassen. Verriet ein Glasbläser das Geheimnis der Glasherstellung, drohte ihm die Todesstrafe.
Einer, der viele Jahrhunderte später die Insel verließ, um sein Wissen mit anderen Glaskünstlern zu teilen, war Maestro Gianni Toso. Seit bereits 700 Jahren war seine Familie im Glashandwerk tätig und schon im Alter von 10 Jahren wusste Gianni Toso, dass er in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten will. Ohne Wissen und Erlaubnis seiner Eltern begann er in einer Glasfabrik zu arbeiten – für einen Dollar pro Woche bei einem 12-Stunden Tag. Mit 14 wurde er in die Abate Vincenzo Zanetti, die Kunstakademie Maestro d’Arte für Glasbläsermeister auf der Insel Murano, aufgenommen. Sieben Jahre lang lernte er nicht nur das Glasblasen, sondern auch Design, Kunstgeschichte und Malerei. Nebenbei arbeitete er bei den besten Maestros in zwölf verschiedenen Fabriken und lernte so in 14 Jahren die Geheimnisse der venezianischen Glasbläser kennen.
Mit Mitte 20 verließ Toso die Fabriken und eröffnete ein eigenes kleines Studio im jüdischen Ghetto von Venedig. Hier begann er sich auf künstlerische Art mit dem Glasblasen auseinanderzusetzen. 1969 schuf er sein berühmtes gläsernes Schachspiel „Juden gegen Katholiken“, auf dem katholische Franziskanerpriester gegen chassidische Juden kämpften. Es gewann damit den ersten Preis in einer Ausstellung von Muranos Meisterglasbläsern und wurde kurz darauf von Salvador Dali beauftragt, eine Serie von zwölf surrealistischen Blumen des Malers in Glas herzustellen.
1972 wurde Gianni Toso als einziger Venezianer zum Internationalen Glassymposium im Museum Bellerive in Zürich eingeladen. Auch wenn zu dieser Zeit keine Glasbläser mehr wegen Geheimnisverrats hingerichtet wurden, war es für Toso doch eine schwere Entscheidung. Was konnte und durfte er mit ausländischen Glaskünstlern teilen? Er hatte immer gedacht, Glas sei ein Medium für das Handwerk, doch auf diesem Symposium wurde ihm klar, das auch das Glasblasen
eine Kunstform ist, die „eine Art ist, Menschen zum Nachdenken zu bewegen, einen Raum zu öffnen und Türen zu öffnen“.
Vielleicht war dieser Gedanke ausschlaggebend für das Schaffen unserer Objekte des Monats. 18 Schlüssel aus weißem Glas hat der Künstler 1973 geformt. Filigran, teilweise dünner als ein Zahnstocher und völlig ohne Zweck, außer dem einen, das Auge zu erfreuen. Warum und für wen die Schlüssel gefertigt wurden, ist nicht bekannt. Aus den Unterlagen des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums geht jedoch hervor, dass sie 1974 vom damaligen Vorsitzenden der
Förderungsgemeinschaft des Museums und Leiter der Schlüsselfabrik Berthold Neumann & Co. aus Essen-Heidhausen, Herrn van den Kerkhoff, von einem Kölner Kunsthaus erworben wurden. Erst kürzlich tauchten die Schlüssel – leider unvollständig und zum Teil beschädigt – bei einer Depotinventur im Zuge des Museumsumzugs zufällig wieder auf. Wie viele Jahre mögen diese kleinen gläsernen Schätze in ihrem Karton geschlummert haben?
Gianni Tosos Werke werden heute in Galerien und Privatsammlungen in den USA, Australien, Belgien, Deutschland, Israel und Japan ausgestellt. Um diesen außergewöhnlichen Künstler, der zu den besten Glasbläsern der Welt zählt, zu ehren, sollen die verbliebenen 16 Schlüssel nach der Eröffnung des neuen Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums in einer besonderen Vitrine im Foyer des Neubaus für einige Zeit ausgestellt werden.
Karina Medić