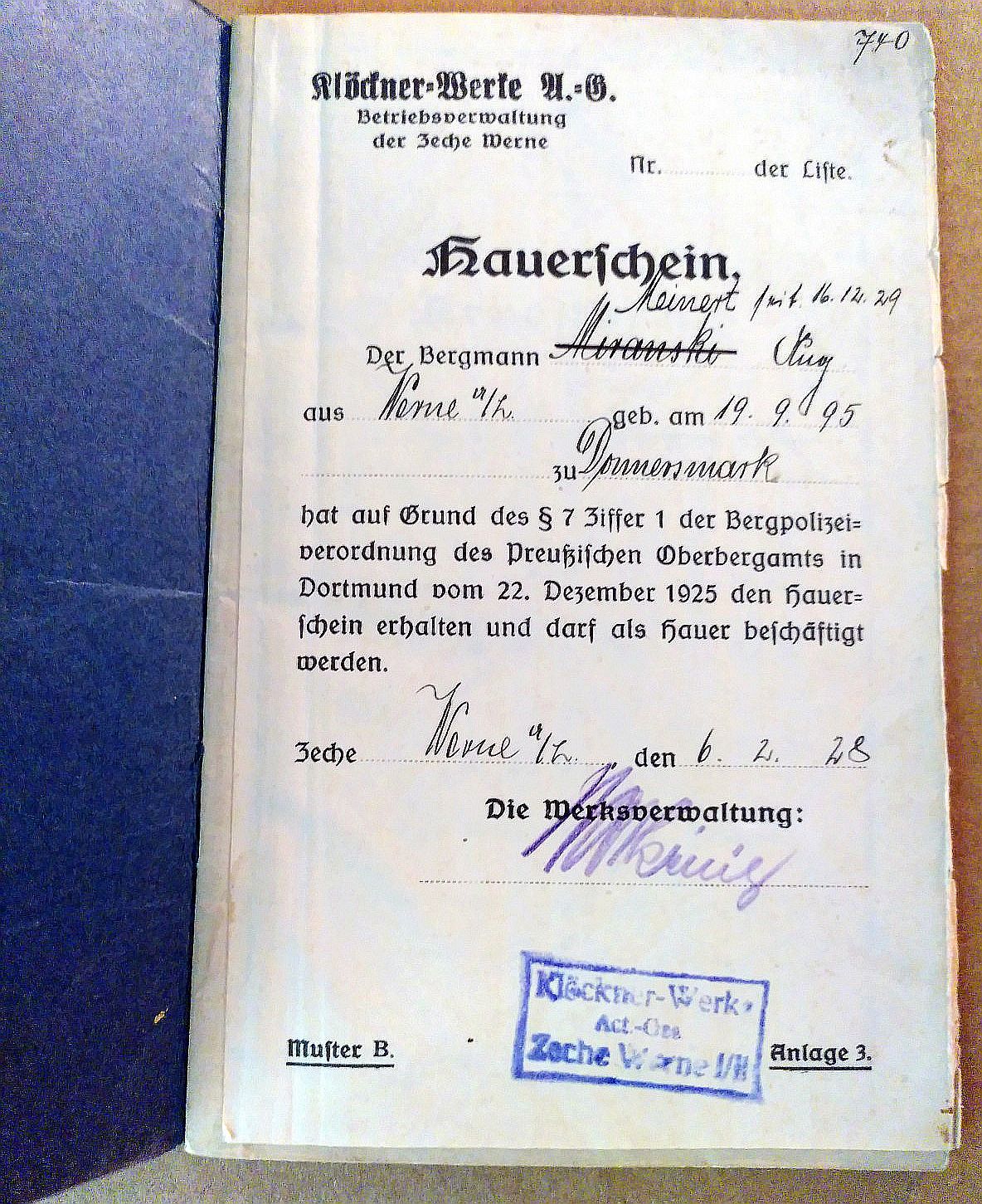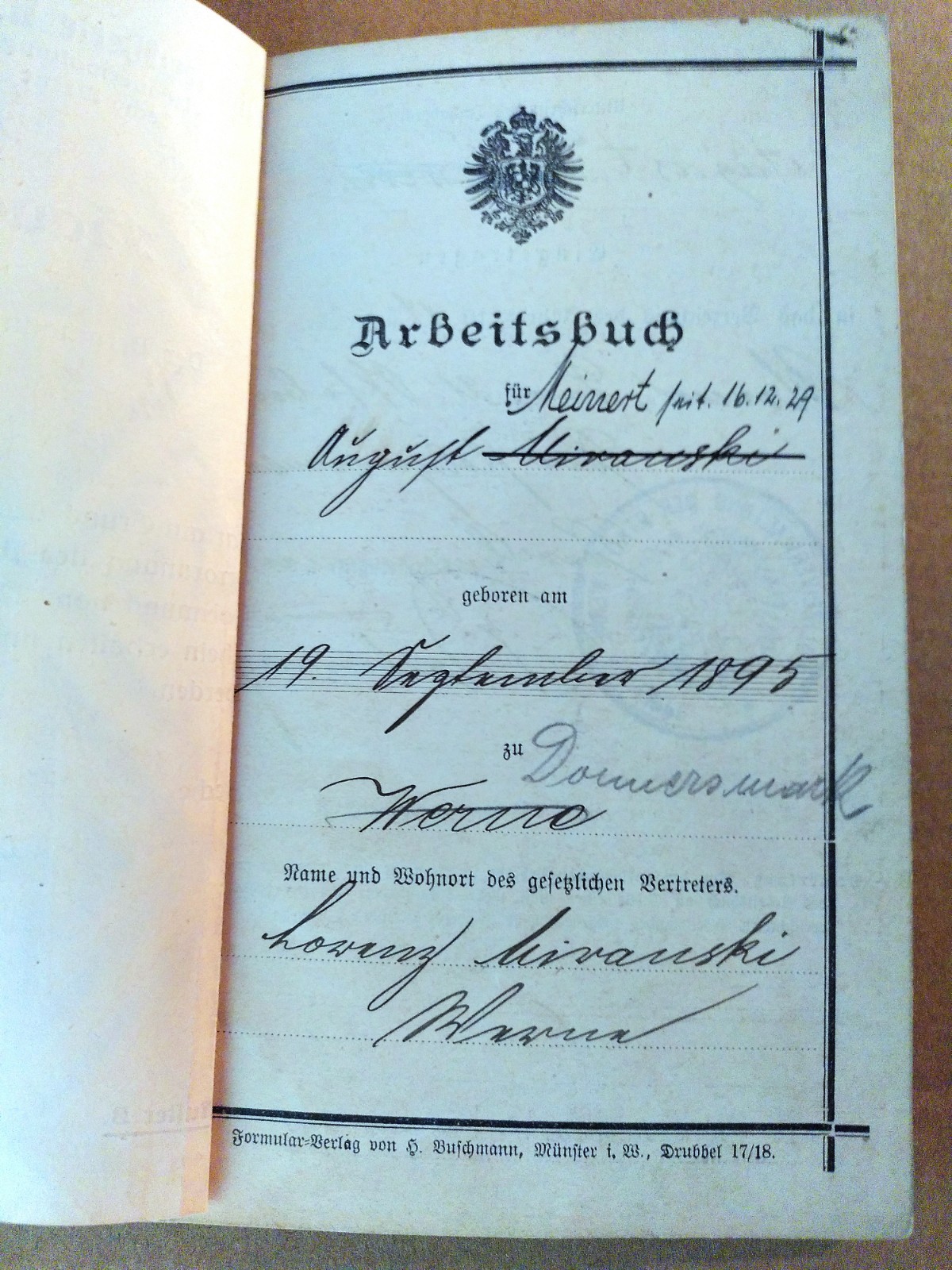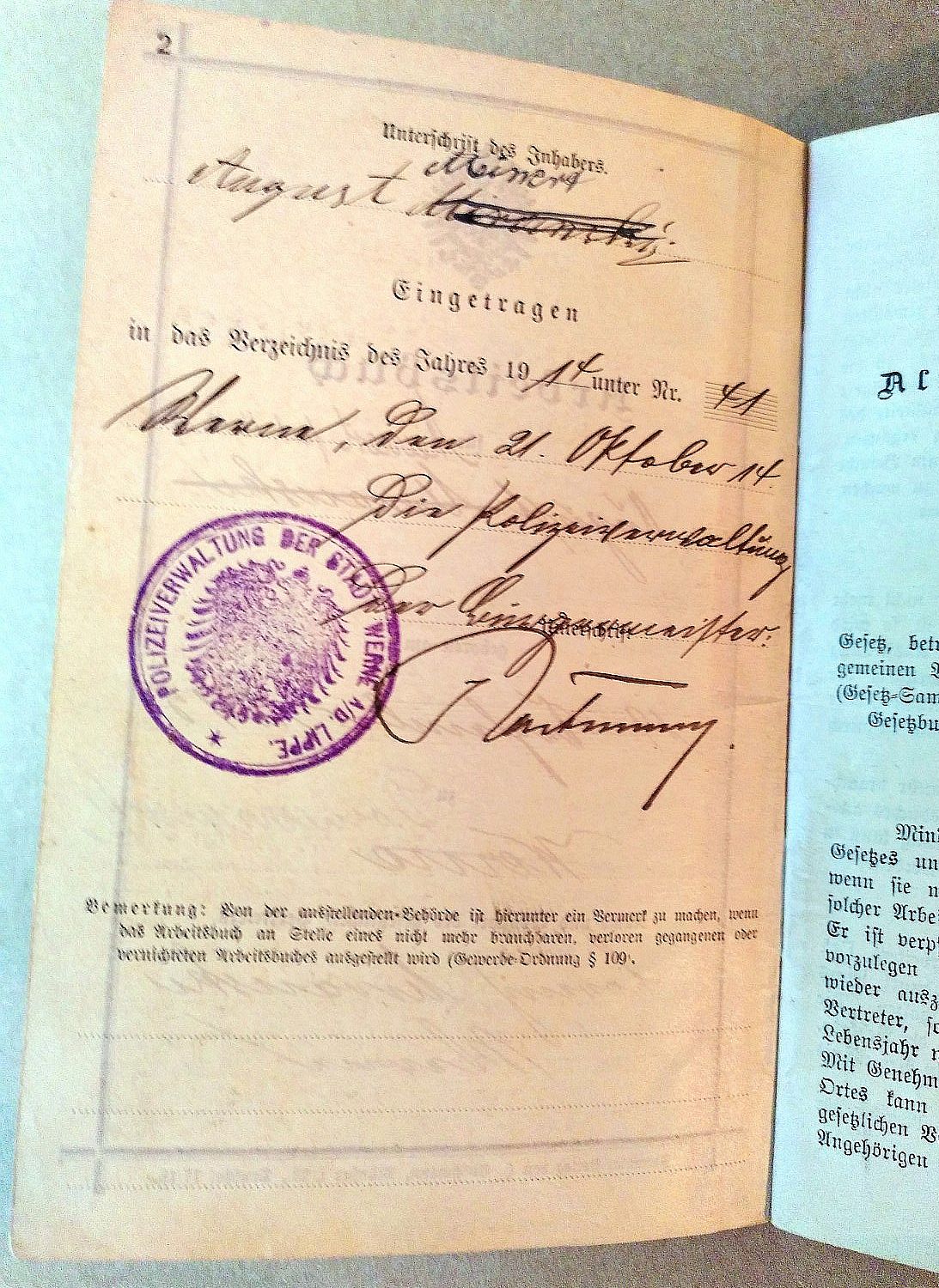Manche Schlüssel haben eine rein symbolische Bedeutung. Einen dieser Art, einen römischen Fingerringschlüssel, hat unser Kollege aus dem Schloss- und Beschlägemuseum Velbert im Januar vorgestellt. Die meisten Schlüssel haben jedoch einen praktischen Nutzen. Mit dem passenden Schlüssel und dem versteckten Schlüsselloch lässt sich die abgebildete Truhe aus dem Museum und Forum Schloss Homburg öffnen.
Die sogenannte flache Kastentruhe aus Fichtenholz steht auf Kugelfüßen und ist mit umlaufenden Endlosfriesen in Form liegender Achten versehen. Diese Stilistik verweist auf eine bergische Herkunft. Die Ornamente der Truhe lassen auf eine Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schließen.
Die Truhe stammt aus dem Familien-Besitz von Peter Kauert (1672 – 1750), dem Besitzer der ehemaligen Grube „15 Löwenpfähle“ in Engelskirchen-Kaltenbach. Seine Enkelin Elfriede Kauert aus Leichlingen berücksichtigte in ihrem Nachlass Schloss Homburg als Erbin. So kam die Truhe 1985 in den Besitz des Museums.
Peter Kauert war damals ein erfolgreicher Eisenerzpionier. Seine Rechte ließ er sich vom Verwaltungsvorgesetzten bestätigen und kennzeichnete sein Grubengebiet mit fünfzehn Pfählen ab, in denen der bergische Wappenlöwe eingebrannt war. Durch den Bau einer Wasseranlage konnte er Pumpen zum Entwässern der Gruben installieren und noch mehr Eisenerz fördern. Eine eigene Schmelzanlage zur Weiterverarbeitung in der eigenen Hütte erweiterten Kauerts Unternehmen. Seine Erfolge erzeugten Neid und Anschuldigungen. Bis zu seinem Lebensende musste er zahlreiche Klagen abwehren. Nach seinem Tod 1750 hinterließ er seinen Kindern ein stattliches Vermögen und schon zu seinen Lebenszeiten war er als der „reiche Kauert“ hochangesehen. 1863 wurde der Grubenbetrieb eingestellt und die Eisenschmelzhütte auf Abbruch verkauft.
Die Museumssammlung auf Schloss Homburg beherbergt zahlreiche Truhen. Aktuell sind eine Runddeckeltruhe von 1768 und eine Flachdeckeltruhe mit einem im Deckel aufwändig installierten Verschlusssystem zu sehen. Letztgenannte aus dem Jahr 1650 wurde als Kriegskasse verwendet. Die abgebildete Truhe mit der Inventarnummer 6019 befindet sich im Depot. Sie ist die einzige aus der Truhen-Sammlung, deren Herkunftsgeschichte uns annähernd bekannt ist.
Truhen dienten auch der Aufbewahrung von Aussteuer für junge Frauen. Sie waren häufig ein Hochzeitsgeschenk und beherbergten je nach sozialer Herkunft hochwertige Textilien, handgefertigtes Leinen oder andere Kleidungsstücke. Dies können wir an einem konkreten Beispiel im nächsten Monat vorstellen. Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar verfügt über einen Ehevertrag der belegt, mit welchem „Vermögen“ Caroline Westhoff 1849 heiratete. Ihre große Anzahl an Kleidungsstücken transportierte sie sicherlich in einer Truhe.
Silke Engel, Museum und Forum Schloss Homburg